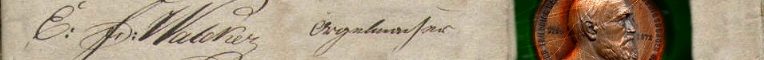(6)
EBERHARD FRIEDRICH WALCKER
DIE MÜNSTER-ORGEL IN ULM
Eine der interessantesten, aber auch umstrittensten Aufgaben, die Eberhard Friedrich in seiner Orgelbauerlaufbahn gestellt wurde, war die Erbauung und Aufstellung der Münsterorgel in Ulm. Nach den im städtischen Archiv in Ulm aufbewahrten diesbezüglichen Akten wurde von Seiten der Münsterbauleitung zum erstenmal im Jahre 1831 mit ihm über die Orgelfrage im Ulmer Münster verhandelt. Die Verhandlungen wurden aber bald wieder abgebrochen und erst im Jahre 1841 wieder aufgenommen. Die Verhandlungen hatten zwar auch dann und bis zur Vollendung des Werkes immer einen schleppenden Gang. Vor allem spielten finanzielle Fragen von Anfang an eine hemmende Rolle. Dafür liefert folgender Brief Eberhard Friedrichs vom 19. Februar 1843 ein charakteristisches Beispiel:
„Euer Hochwürden Herrn Stadtpfarrer Landerer an der Münsterkirche in Ulm. Eine besonders erfreuliche Nachricht gibt mir Ihr sehr verehrtes Schreiben vom 8. ds. Mts., indem es dem längst gehegten Wunsch entgegenkommt, doch auch einmal im Vaterland ein Werk von größerem Umfang in einem demselben gemäßen Lokale bauen und aufstellen zu können.
Obgleich man gegenwärtig in Stuttgart alles mögliche darauf verwendet, ein schönes und großes Werk in die Stiftskirche bauen zu lassen, so würde ich mir doch eine Orgel in der Ulmer Münster-Kirche zu weit größerer Ehre anrechnen, weil dorten Orgel und Lokal miteinander übereinstimmen und erstere eine viel großartigere Wirkung haben würde; ich erinnere mich hierbei der Wirkung meiner Orgel in der 120 Fuß hohen St. Olai-Kirche in Reval.
Zu § l Ihres verehrten Schreibens muss ich Ihnen wohl bemerken, dass seit der Übergabe meines Kostenüberschlages die Holzmaterialienpreise sich etwas erhöht haben, und dass durch meine seitherige Übung im gotischen Baustil die Ausführung des Gehäuses jedenfalls edler und schöner werden würde, als meine damals entworfene Zeichnung besagt; dass ferner durch meine allgemein als vorzüglich anerkannte neue Erfindung bei Windladen, als dem Herz der Orgel, der Materialaufwand etwas kostspieliger wird, die Windladen aber auch um so dauernder und zuverlässiger werden. Es dürfte also bezüglich der Berechnung des Gehäuses und der Windladen eine kleine Differenz eintreten.
Für die Zeit, in welcher das Werk gebaut werden soll, müsste ich mir womöglich fünf Jahre bedingen, weil ich mich auf meiner letzten russischen Reise abermals auf Bestellungen eingelassen und zwei bedeutende Werke, das eine für Helsingfors, der jetzigen Hauptstadt von Finnland, das andere für Petersburg, zu bauen übernommen habe. ,
Zu § 3 in betreff der Unterhaltung der alten Orgel bin ich rücksichtlich des Neubaues gerne geneigt, dieselbe jetzt so weit herzustellen, dass sie bis zur Aufstellung des neuen Werkes aushält, und würde ich dafür nur eine geringe Verfügung für Reise und Aufenthalt von etwa 70—80 Gulden in Anspruch nehmen ..."
Im Verlaufe der weiteren Verhandlungen legte Walcker noch eine ganze Reihe von Projekten und Kostenberechnungen vor mit immer neuen verbesserten und reicheren Dispositionen.
Alle diese Briefe und Vorschläge beweisen, wie bei Eberhard Friedrich immer die Sache, vor allem das musikalisch unbedingt Notwendige im Vordergrund stand. Um dies Notwendige kämpfte er bis zum äußersten.
Bei der Ulmer Orgel trat zunächst die Platzfrage in den Vordergrund, die Frage, ob die neue Orgel auch wieder in den Raum unter dem Turm eingebaut werden solle, in dem auch die alte stand, oder ob sie über dem Hauptportal im linken Seitenschiff des Münsters auf einer besonders zu erbauenden Empore aufgestellt werden solle. Darüber wurde mit Leidenschaft gekämpft. Die Anschaffung einer neuen . Orgel war nämlich nicht nur aus musikalischen Rücksichten ins Auge gefasst worden, sondern man sah darin zugleich die Teilaufgabe einer allgemeinen großen künstlerischen und architektonischen Restaurierung des ganzen Innenraumes des Münsters. So wurde sowohl die Form als der Platz der Orgel mit dieser grundsätzlichen künstlerischen Neuordnung aufs engste verknüpft. Die königliche Kreisregierung des Donaukreises verlangte, dass ein für diese Fragen besonders geeigneter Vertreter des höheren Baufaches von der Staatlichen Kunstschule in Stuttgart, — und als man damit allein nicht zurechtkam — deren Leitung selbst Vorschläge für diese Raumgestaltung einschließlich der Orgelfrage machen solle. So wurde denn auch am 14. Oktober 1846 eine umfangreiche Denkschrift von der Kunstschule vorgelegt, in welcher die Orgel über das Hauptportal im Seitenschiff verwiesen wurde. Die vom Stiftungsrat des Ulmer Münsters mit einer Stellungnahme zu dieser Frage beauftragte Kommission, bestehend aus Stadtbaumeister Rupp-Reutlingen, Stadtbaumeister Thrän-Ulm und Orgelbauer Walcker-Ludwigsburg, setzte sich dafür ein, die neue Orgel wieder im Turmraum einzubauen, wenn auch mit einigen wesentlichen Änderungen des Unterbaues.
Der Streit über diese Frage hatte sich vorher schon zwischen einem Vertreter der Kunstschule, Dr. v. Mauch, und der Baukommission jahrelang hingezogen, ohne zu einer Lösung zu kommen. Nun forderte das Gutachten der Kunstschule kategorisch eine Entscheidung, und wieder ist es bezeichnend, wie Eberhard Friedrich, der sich doch als Geschäftsmann um den Auftrag bewarb, von sich aus mit einer wuchtigen Gegendenkschrift zu dieser Streitfrage Stellung nahm.
Die Denkschrift ist sowohl stilistisch wie inhaltlich, vor allem aber in ihrem kämpferischen Geist und in ihrem Bekennermut wirklich bemerkenswert und aufschlussreich, auch als Dokument der Zeit, und soll deshalb teilweise im Wortlaut wiedergegeben werden:
Ludwigsburg, 14. Dezember 1846.
Erwiderung des Orgelbauers Walcker in Ludwigsburg auf die Note der Direktion der Königlichen Kunstschule in Stuttgart vom 14. Oktober dieses Jahres, den Bau und die Stellung der projektierten Orgel für das Münster in Ulm betreffend.
Die Direktion der Königlichen Kunstschule in Stuttgart beginnt ihre Kritik des in Vorschlag gebrachten neuen Orgelwerkes für das Münster in Ulm damit, dass sie nachzuweisen sucht, die Mängel, die die bisherige Orgel und ihr Standort im Gefolge gehabt habe, führe nicht nur die neuerlich beabsichtigte Stellung ebenfalls mit sich, sondern einen derselben sogar in noch höherem Grade. Der innere Bau dieser Kirche, heißt es in der Denkschrift, sei durch die bisherige Stellung der Orgel stark beeinträchtigt und entstellt worden, „da dieselbe auf die großartige und schmuckreiche Vorhalle des Hauptportals, statt der Perspektive der Kirche einen dumpf eingeschlossenen, kellerartigen Raum folgen lasse, wo das Auge durch den Anblick der Rückseite der Orgel und ihrer für die Verborgenheit bestimmten Apparate einen mit dem beabsichtigten, in direktem Widerspruch stehenden Eindruck erhalte". Was nun zuerst den positiven Teil dieses Tadels, sofern er auch dem neuen Orgelwerk gelten soll, betrifft, so ist der neue Unterbau der Orgel — ein von den Herren Rupp, Thrän und Spaich projektiertes Werk — keineswegs „ein dumpfer, kellerartig eingeschlossener" — wie es später noch in der Schrift heißt — „unwürdiger" Vorraum, sondern eine gefällige, freundliche, auf eine der Kirche würdige Weise verzierte, 96 Fuß hohe, 47 breite, von zwei über den Kirchtüren angebrachten 16 Fuß hohen, 10 Fuß breiten bemalten Fenstern beleuchtete, sehr geräumige Vorhalle, in der das Auge so wenig durch den Anblick der Rückseite der Orgel und der für die Verborgenheit bestimmten Apparate, Blasbälge etc. beleidigt wird, dass vielmehr sowohl diese als jene gar nicht sichtbar werden, und dass die Halle selbst eine weitere Zierde des Münsters, ja für die schmuckleeren Seitenwandungen des Turmraumes eine höchst wünschenswerte Dekoration genannt werden darf ..."
Die zweite Ausstellung geht dahin, dass „das große Portal und Kirchenfenster, das einen so wesentlichen Teil des architektonischen Organismus ausmacht, durch den neuen Bau verdeckt werde". Auch hier kann einfach auf die beigeschlossene Durchschnittszeichnung verwiesen werden. Wie Linie C—D hinlänglich beweist, so kann das Portalfenster von der Kanzelgegend aus vollkommen gesehen werden, und je weniger es dem Kunstverständigen verborgen sein kann, dass der die gewünschte Wirkung hervorbringende Prospekt eines Gegenstandes nicht in dessen unmittelbarer Nähe gewonnen wird, desto entschiedener dem mit der Lokalität Vertrauten ist, dass gerade der Prospekt, den man von der Kanzelgegend aus erhält, der vorteilhafteste ist, desto weniger sollte man geränkelt werden können, ob er nun etliche Schritte vor- oder rückwärts erreicht wird.
Der dritte Teil endlich, „dass der innere Raum der Kirche auch durch den neuen Plan eine dem Bauplan widersprechende Verkürzung erleide", kann kaum im Ernst gemeint sein. Denn der ganze ungeheure Raum von über 1100 Fuß, welche die Länge der Münsterkirche ausmachen, wird doch dadurch, dass ihm kaum 30 Fuß entzogen werden, gewiss nur um einen recht winzigen Teil verkürzt.
Das zweite Bedenken, „dass die Orgel in solcher Zurückstellung — um 14 Fuß — weniger Licht als die alte in der Front erhalten würde", gibt aber damit selber zu, dass bei einer Zurückstellung von 47 Fuß auf B dieser Übelstand um ein sehr Bedeutendes größer werden müsste, denn von dem Fenster in der Portalwand würde, wenn seinerzeit gemalt, weit weniger Licht für die Orgel und Musikchor zu erwarten sein, als vom Mittelschiff aus denselben auf A verschafft werden kann, besonders wenn die oberen kleinen Fenster gereinigt werden wollten.
Wenn die Denkschrift ferner behauptet, „die neue Orgel würde von keinem Punkt des Mittelschiffs ganz übersehen werden können, so wird abermals auf beiliegenden Grundriss und die Figur B—C—D verwiesen. Diese liefert den schlagenden Beweis, dass von dem Punkte b aus das ganze Werk übersehen werden kann. Dabei soll indessen nicht geleugnet werden, dass die Orgel auf B imposanter plaziert wäre. Da aber mit dieser Stellung auf B Nachteile verbunden wären, die — wie weiter unten gezeigt werden wird — der Bedeutung der Orgel selbst den absoluten Eintrag täten, so kann es sich offenbar nicht darum handeln, ihr mit Aufopferung ihres Hauptzweckes die möglichst imposante, sondern diejenige Stellung zu geben, die ihrem Zweck entsprechend und doch zugleich der Würde des Hauses angemessen ist.
So sehr nun aber aus dem bisher Gezeigten zu erhellen scheint, dass weder die aus dem Gebiet der Architektonik, noch aus dem der Orgelbaukunst hergeleiteten Bedenken von Erheblichkeit sind, so würde doch der Orgelbauer selbst an der Herrlichkeit des Baues sich zu versündigen glauben, wenn wirklich nur einige Modifikationen in der Einrichtung der Orgel nötig wären, um derselben diejenige Stellung zu geben, die in der Note der Königlichen Kunstschule als die dem ganzen Organismus des Münsters entsprechende mit den Worten bezeichnet wird: „Nach dem Vorstehenden müssen wir die Stellung der Orgel an der Wand des Haupteinganges für die einzige erklären, welche dem Bau der Kirche die gebührende Rechnung trägt."
Gerade gegen diese Ansicht aber muss der Orgelbauer als der in Beziehung zur Orgel zunächst Sachverständige die entscheidende Einsprache erheben. In dieser Stellung nämlich könnte die Orgel wohl für sich als ein großartiges Werk und brauchbar zu freiem Orgelspiel hingestellt werden, aber zur Begleitung und Leitung des Gemeindegesangs wäre sie geradezu unverwendbar, denn die Schallkraft der Pfeifen würde sich in dem teilweise von dem übrigen Kirchenschiff abgeschlossenen Raum von den Seitenwandungen nach den verschiedensten Richtungen vor den Ohren des Spielers brechen, so dass derselbe statt seines eigenen geregelten Spieles nur ein Chaos von Tönen, am allerwenigsten aber den Gesang der Gemeinde hören würde, nach dem er sich doch hinsichtlich des Zeitmaßes und der Tonstärke notwendig richten muss. Wollte er sich aber etwa durch schwächeres Registrieren helfen, um den Gemeindegesang hören und beurteilen zu können, so klänge die Orgel zu schwach, um von der Gemeinde gehört und verstanden zu werden, ein Missstand, der in manchen Kirchen auf eine beklagenswerte Weise stattfindet und in einem Dome wie dem Ulmer Münster schlechthin unverbesserlich wäre. Wenn sich aber die Denkschrift in dieser Frage auf die große Notre-Dame-Kirche in Paris beruft, so beweist dieses Beispiel nicht das geringste. Denn der protestantische Gottesdienst stellt bekanntlich ganz andere Anforderungen an die Orgel als der katholische, bei welchem die Hauptorgel nur selten zu großen Intonationen gebraucht, dagegen zum Dienst der Messe gewöhnlich nur eine kleine, oft sogar tragbare Chororgel verwendet wird.
Neben dieser Haupteinwendung gegen den Vorschlag der Note (Denkschrift) steht aber noch eine zweite, die ebenfalls von großer Bedeutung ist. Stünde die Orgel auf B, so würde die Orchesterbühne ein dunkles, ebenfalls von dem Kirchenschiff teilweise abgeschlossenes Gelas, in welchem sich die Töne in der Art fangen würden, dass hundert Personen kaum das wirken könnten, was von A aus dreißig Personen leicht zu leisten vermögen.
Endlich berührt die Note selbst noch einen bei der von ihr vorgeschlagenen Stellung der Orgel sich ergebenden Übelstand, der aber keineswegs so kurzhin, wie sie es tut, abgetan werden kann, sondern der ernstlichen Beachtung bedarf. Wir meinen die Folgen, die die Stellung der Orgel an die Portalwand für die Ausübung des Predigtamts haben müsste. In Beziehung hierauf äußert sich die Note: „Wenn endlich gar für die Stimme des Predigers bei dieser Stellung der Orgel Besorgnisse geäußert werden, so haben wir nur zu bemerken, dass es Sache des Predigers ist, der die Kanzel eines Domes wie des Ulmer Münster besteigt, seinen Vortrag den in der Beschaffenheit einer solchen Lokalität begründeten Bedingungen anzupassen." Die Note scheint also der Ansicht zu sein, der Mensch könne seiner Stimme nach Belieben, und wenn es bis ins Unendliche wäre, an Umfang zulegen, jedoch ahnend, dass das doch nicht möglich sein möchte, beschwichtigt sie unmittelbar darauf die Fragenden mit den Worten: „die neue Stellung der Orgel würde keine Veränderung mit sich bringen, dass der bei der bisherigen Stellung der Orgel verstandene Prediger nicht auch bei der neuen verstanden werden wird." Dies ist eben der entscheidende Irrtum. Wollte der Prediger, wenn die Orgel an der Portalwand stünde, verstanden werden, so müsste er statt einer 8-füßigen Stimme eine 32-füßige erklingen lassen. Da aber dies für jeden Menschen unmöglich ist, so wäre von nun an der Prediger auf der Kanzel nur eine Figur für die Zuhörer auf A, deren Stimme zwar gehört, aber unverstanden verhallen würde. Warum legt nun aber — und hier gehen wir zu derjenigen Seite der Frage über, auf der offenbar das entscheidende Gewicht ruht — warum legt die Note so wenig Wert auf die ungünstigen Folgen, die aus der Stellung der Orgel in die Portalwand entspringen? Dies erhellt aus den Worten, womit sie ihren Plan einführt. Es sind folgende: „Ist dieser Bau des Münster etwas einzig Schönes und Großes und ein Werk von der größten Kostbarkeit, so gestehen wir, nicht zu begreifen, wie gegenüber den im Organismus dieses Baues begründeten Forderungen einige Modifikationen in der Einrichtung der Orgel in überwiegenden Anschlag gebracht werden können." Diese Worte, zusammengehalten mit denen, die über die Ausfüllung der Kirche durch die Stimme des Predigers schon angeführt worden sind, beweisen zur Genüge, dass die Note sich auf den rein architektonischen Standpunkt stellt, auf den kirchlichen Gebrauch des Domes aber nur insoweit Rücksicht nehmen will, als alle Rücksichten ihres Standpunktes unbeeinträchtigt bleiben. Hätten wir es nur mit einem für den katholischen Kultus bestimmten Bauwerk zu tun, so käme in diesem Falle der architektonische Standpunkt mit dem kirchlichen durchaus überein, wie oben gezeigt worden ist. Nun haben wir es aber in vorliegendem Falle mit einer für den protestantischen Kultus bestimmten Kirche zu tun, und von diesem Standpunkt aus muss — so begreiflich es sein mag, dass auch hier der Künstler sein Bauwerk in seiner ganzen Majestät prangen sehen möchte — gegen die rücksichtslose Anwendung des bloß architektonischen Maßstabes die kräftigste Einsprache erhoben werden.
Die Hauptseiten des protestantischen Kultus sind der vom Orgelspiel getragene Gemeindegesang und die Predigt. Würde eine evangelische Gemeinde es sich gefallen lassen, um eines architektonischen Eindrucks willen sich die beiden Elemente ihrer kirchlichen Erbauung rauben zu lassen, so würde sie eben damit ihren protestantisch-kirchlichen Charakter verleugnen und zugestehen, dass ihr das künstlerisch vollendete Bauwerk höher stehe als ihr eigenes inneres Leben, das mit dem kräftigen Bestehen jener beiden Elemente steht und fällt. Ferne sei es, hiermit leugnen zu wollen, als ob sie nicht die strengste Pflicht hätte, ein kirchliches Bauwerk, das ihr anvertraut ist, auf jede, von der Kunst gebotene und vorausgesetzte Weise zu pflegen und dabei in jeder Rücksicht der Kunst zu geben, was der Kunst gebührt; ferne sei es namentlich, leugnen zu wollen, als ob nicht besonders das Ulmer Münster ein Kleinod wäre, für dessen würdige Behandlung die Gemeinde, die es ihr Eigentum nennen darf, der Mit- und Nachwelt der ganzen Christenheit verantwortlich ist. Aber dieses herrliche Bauwerk ist nun einmal nicht als evangelische Kirche erbaut und darum hat es seine großen Schwierigkeiten, es zu ihrem Zweck zu benützen. Soll es nun aber deswegen unbenutzt bleiben? Oder sollen die Verbesserungen zur Benützung derselben nur so getroffen werden, dass dieselbe doch nicht wirklich oder nur im kleinsten Maßstabe möglich ist? Dann würde die kirchliche Kunst, die doch nur mit dienen soll zum Lobe Gottes und zur Erbauung der Gemeinde, zur Herrscherin werden, die da, wo sie nur integrierender Teil ist, sich zum Ganzen aufwerfen und eben damit sich selbst vernichten würde. Also auch im herrlichen Ulmer Münster sollen und müssen solche Einrichtungen getroffen werden, dass eine seine Räume erfüllende Gemeinde auf wahrhaft evangelisch-protestantische Weise durch Gemeindelied und Predigt sich zu erbauen vermag. Kann dies geschehen, auch ohne dass der schlagende Eindruck der Perspektive nur um das geringste vermindert, auch ohne dass der Längenraum nur um eine Linie verkürzt, auch ohne dass die subtilste architektonische Rücksicht verletzt wird, — wer wird sich darüber nicht von Herzen freuen? Kann dies aber nicht anders geschehen, als dass den höchsten architektonischen Ansprüchen ein klein wenig abgebrochen wird, jedoch so, dass der Würde des Baues und der Großartigkeit seiner Wirkung im wesentlichen kein Abbruch geschieht, so darf kühn behauptet werden, dass — vermöge des tiefen kirchlichen Sinnes, in dem die kirchlichen Bauwerke des Mittelalters entworfen und ausgeführt worden sind — der fromme Urheber dieses Münsters, wenn er jetzt ein Mitglied der evangelischen Gemeinde Ulms wäre, der erste sein würde, der ja dazu sagte. Denn gerade aus dem Sinn heraus, in dem er die Idee seines Baues erfasste und die Stadt Ulm ihn auszuführen beschloss, muss allen übrigen Wahrheiten die vorangehen: „Auch die kirchlichen Bauwerke sind um der Gemeinde willen, nicht die Gemeinde um der Bauwerke willen da."
Der Stiftungsrat der Münstergemeinde trug sich angesichts dieser scharfen Gegensätze zeitweilig mit dem Gedanken, die Streitfrage durch ein Schiedsgericht entscheiden zu lassen, dessen Spruch endgültig sein sollte. Er wurde aber offenbar nicht weiter verfolgt. Dagegen wurden die beiderseitigen Gutachten und alle vorausgehenden Vorschläge dem Regierungsbaurat Zwirner in Köln, der den dortigen Dom zu betreuen hatte, zur gutachtlichen Äußerung zugesandt. Aber auch das kam nicht zum Zug. In einem Brief von Stadtbaumeister Thron in Ulm an Zwirner vom 23. März 1848 wird diesem mitgeteilt, dass auf sein Gutachten verzichtet wird und dass der Plan Walckers genehmigt sei. Walcker selbst erhielt diese Nachricht auch zuerst durch den Stadtbaumeister. Er gibt seiner Freude darüber in einem Brief an Thrän folgendermaßen Ausdruck:
„Ludwigsburg, den l. April 1848. Verehrtester Freund!
Sie haben mich mit der Nachricht Ihres Schätzbaren vom 22. ds. Mts. wahrhaftig entzückt, und komme ich diesmal bloß, hiefür meinen schuldigen und verbindlichen Dank abzustatten. Es hat bei uns dahier über den errungenen Sieg allgemeine und zwar große Freude geherrscht, und bin ich nur noch auf die weiteren Nachrichten, welche Sie mir mitzuteilen die Güte haben wollen, sehr gespannt, und wäre mir angenehm, wenn ich hierauf nicht gar zu lange warten dürfte .
(gez.) Eberhard Friedrich Walcker.*
Wann dann der Auftrag wirklich erteilt wurde, ist aus den vorhandenen Akten, die gerade aus jener Zeit erhebliche Lücken aufweisen, nicht ersichtlich. Dagegen ist festzustellen, dass die Arbeiten von Anfang an sehr schleppend und begleitet von dauernden Differenzen in der Preisgestaltung und über die Klanggestaltung der Orgel vor sich gingen.
Aus einer großen Anzahl von Briefen Walckers aus jenen Jahren ergibt sich außerdem, dass es vielfach auch an der richtigen Zusammenarbeit zwischen der Bauleitung in Ulm und dem Orgelbauer gefehlt hat. Immer wieder klagt er, dass die und jenen Vorarbeiten nicht rechtzeitig ausgeführt werden, vor allem aber, dass unbedingt notwendige Pläne trotz Versprechungen einerseits, Monitorien andererseits nicht geliefert werden. Schließlich macht sich der ganze angesammelte Groll in einem Brief Walckers Luft, der Gewitterstimmung verrät. Er lautet:
„Ludwigsburg, 23. Januar 1855 Lieber, verehrter Freund l
Bis daher hat es sich bloß um pekuniäre Nachteile gehandelt, deren ohngeachtet ich allem aufgeboten und das Geschäft fortgesetzt habe; nun aber handelt es sich um eine weit größere Verantwortung, die ich einerseits für das Gelingen des Werkes, andererseits gegen meine Leute und gegen meinen Sohn zu beobachten habe. Nicht nur hat die Arbeit in kalten und strengen Wintertagen keinen gedeihlichen Fortgang genommen, sondern ist sogar hinsichtlich der Gesundheit nicht selten von den allerschlimmsten Folgen. Zweitens ist es das größte Risiko hinsichtlich der Benutzung des Feuers und Lichtes, an einem Werk von solchem Wert unter solch ungünstigen Witterungsverhältnissen noch immer fortarbeiten zu wollen, und es nahm mich eigentlich wunder, wie man das Geschäft seither vom feuerpolizeilichen Standpunkt aus nur bisher hat fortsetzen lassen, während es mir schon manche große Sorge gemacht hat.
Drittens ist alles das, was jetzt gestimmt wird, total vergebliche und zum Teil solche Arbeit, die ohne Nachteile des Pfeifenwerkes gar nicht wieder korrigiert werden kann und die ich unter gar keiner Bedingung in dieser Jahreszeit weiter fortsetzen lassen könnte. Überhaupt hat mich die bisher vorgeschriebene Geschäftsordnung, die ich mir aus lauter Bescheidenheit und Respekt gegen den Stiftungsrat gefallen ließ, schon in zu großes Unheil, Not und Verlegenheit gebracht, dass ich diese Plackerei fernerhin fortzusetzen, um dadurch der Kasse nur noch weiteren Schaden zu verursachen, mir nicht weiter vorschreiben lassen kann. Hätte man mir seinerzeit nicht die Windladen und Pfeifen mit aller Gewalt abverlangt, ehe sie in Ludwigsburg haben eingepasst und gestimmt werden können, weil das Gehäuse und der übrige Inbau erst eineinhalb Jahre später fertig wurden, so wäre so viel Zeit eingeteilt worden, dass wir gar nicht nötig hätten, uns im Winter herumzuschlagen und zu behelfen. Mein Sohn teilte mir kürzlich mit, dass Sie sich über die Ausführung des Gehäuses sehr unbestimmt ausgesprochen haben; ich möchte daher bitten, mir darüber bestimmte Mitteilungen zu machen, damit diese Arbeit vorerst ausgeführt wird, ehe wir aufs Frühjahr wieder mit dem Stimmen beginnen. Um die gute Stimmung des dortigen Publikums zu erhalten, ist mich schon teuer genug zu Stehen gekommen und hat doch nichts genützt. Daher glaube ich, ein gutes Endresultat werde mir mehr nützen, als wenn ich meine Zeit und mein Geld nutzlos verplembere, und das kann nur erreicht werden, wenn ich in den Stand gesetzt werde, das Geschäft künftiges Frühjahr mit neuem Mut und neuen Kräften vollenden zu können. Das Hineinstellen der Frontpfeifen ist ebenso zweckwidrig als nutzlos, indem das Gehäuse und alles Dazugehörige vorher fertig sein muss, ehe eine tätige Hand ans Stimmen gelegt wird, denn all das bisherige Stimmen taugt nichts, und alle darauf verwendete Zeit ist, wie oben gesagt, total verloren. Ich bitte daher Sie recht dringend, halten Sie meine Leute nicht länger zurück und geben Sie die Schlusszeichnung meinem Sohne mit den notwendigen Erläuterungen mit, denn so abgestumpft werden Sie es doch nicht enden lassen.
(gez.) Eberhard Friedrich Walcker."
Anfang Oktober 1856 wurde das Werk dann schließlich fertig und konnte am 12. Oktober übergeben werden. Die Spannung und Erwartung weitester Kreise der Bevölkerung war sehr groß und wurde auch nicht enttäuscht.
In der „Schwäbischen Chronik" vom 16. Oktober 1856 heißt es in einem ausführlichen Bericht über die Orgeleinweihung im Münster u. a.: „Die Menge von Fremden, welche in den Tagen des 12. und 13. Oktober die Stadt Ulm belebten, war ein Beweis, mit welchem Interesse man in allen Teilen unseres Landes sowie im benachbarten Bayer- und Schweizerland dem Augenblick entgegengesehen hatte, wo das herrliche Münster mit einem seiner würdigen Orgelwerke geschmückt wäre. Die langjährige Erwartung wurde endlich erfüllt und — mit Freuden dürfen wir es sagen — die Hoffnung nicht getäuscht, die man auf die Kunst unseres berühmten Landsmannes Walcker gesetzt hatte . . . Das ganze Werk, das hoffen wir zuversichtlich, wird seinem Meister für lange Zeiten, für Jahrhunderte vielleicht, zu hoher Ehre gereichen."
Die helle Freude freilich, die wir bei anderen großen Orgeleinweihungen feststellen konnten, brach hier nicht in gleichem Maße durch. Die Streitigkeiten über die Platzfrage, das ewige Markten um den Preis, der schon einige Zeit im Hintergrund drohende Prozess um die Endabrechnung waren einer wirklich befreiten und frohen Feststimmung nicht günstig. Im „Schwäbischen Merkur" wurde zwar das musikalische Programm des ersten Konzertes in erster Linie angefochten und kritisiert, das verhindert habe, die ganze Fülle und Entfaltungsmöglichkeit der neuen Orgel zu zeigen, aber es wurde doch auch angedeutet, dass man die Lösung der Platzfrage für verfehlt halte. In anderen Zeitungen wurde ganz einseitig behauptet, dass an diesem Ort eine volle Entfaltung der Orgel gar nicht möglich sei. Diese Streitfrage kam auch nie ganz zur Ruhe, bis nach Ausbau des Münsterturmes im Jahre 1889 aus diesem neuen Tatbestand heraus auch die Orgelfrage erneut aufgerufen wurde. Eberhard Friedrich hat also an dem Werk, das er in seinem Bewusstsein als Orgelbauer so besonders hoch stellte, auch nach Vollendung desselben nicht die reine Freude erlebt, die er erhoffte. Zu seinem Ruf als Orgelbauer hat sie freilich trotzdem einen weithin wirkenden, wertvollen Beitrag geleistet; auch das stolze Bewusstsein seiner überlegenen Meisterschaft im Orgelbau war unerschüttert und blieb es auch in dem ganzen achtjährigen Prozess, der sich um die Gesamtabrechnung zwischen ihm und dem Stiftungsrat entwickelte. Der Stiftungsrat war anfänglich zu weitgehendem Entgegenkommen bereit, aber Walcker pochte hier auf das Recht und die letzte von ihm errechnete Zahl. Acht Jahre schwäbischer, gerichtlicher Instanzenweg und Kampf mit schwäbischer Feder- und Pfennigfuchserei haben ihn mürbe gemacht, so dass er am 22. August 1864 folgenden Vergleich anbot. Auch dies Schriftstück ist charakteristisch für ihn. Es lautet:
«Vergleichsangebot Walcker an den Stiftungsrat in Ulm. (22. 8. 1864.)
Wir beehren uns, auf Grund unserer Besprechungen über unseren gegen den dortigen Stiftungsrat anhängigen Orgelprozess die Erklärung abzugeben, dass wir uns entschlossen haben, auf eine Abfindung von 6000 Gulden bares Geld unter Vergleichung der Kosten erster und zweiter Instanz uns zu vereinigen. Der Grund liegt nicht in der Furcht, den Prozess in der gegenwärtigen Instanz oder bei der Königlichen Obertribunal zu verlieren, im Gegenteil haben wir die volle Überzeugung, dass das Recht so sehr auf unserer Seite ist, dass wir, namentlich bei einer Taxation von Sachverständigen, nur als Sieger aus diesem Streit hervorgehen können; sondern er liegt darin, dass wir des Prozessierens satt und bei dem Sprichwort angelangt sind, dass ein magerer Vergleich besser sei als ein fetter Prozess. Dieses ist der einzige Grund unserer Nachgiebigkeit, und hoffen wir daher, dass der Stiftungsrat demselben sich unterwirft, um aus der Sache herauszukommen, da auch ihm dieser Prozess nicht zum Vergnügen gereichen kann.
(gez.) Eberhard Friedrich Walcker."
Mit der Stiftskirchenorgel und mit der Münsterorgel wurden zwei besonders verwickelte Beispiele herausgegriffen, an denen zu ersehen ist, mit welchen Schwierigkeiten man zur Zeit Eberhard Friedrichs, zumal in Württemberg, beim Orgelbau zu kämpfen hatte. Sie ließen sich noch um etliche vermehren, würden aber kaum etwas wesentlich Neues hinzufügen können, weder dem Bilde des Mannes und Orgelbauers noch dem der Zeit. Aber sie mussten gezeigt werden, denn an den überwundenen Widerständen erst kann man die ganze Größe und den Wert der Leistung und des sie vollbringenden Mannes ablesen.
Aus Briefen Eberhard Friedrich Walckers an seine Frau und andere Adressen ergibt sich, dass er in den Jahren zwischen 1830 und 1857 allein folgende Städte außerhalb Württembergs zu geschäftlichen Zwecken besuchte: 1832 und spätere Jahre mehrfach Frankfurt a. M. 1835 Offenbach, 1837 Breslau, Weimar, Hamburg, 1838 Petersburg, 1840 Petersburg, auch Triest und Venedig sind genannt, Lambsheim (Pfalz) 1848 Orgelaufstellung, Helsingfors (Finnland) 1850 Orgelaufstellung, Zürich (Schweiz) 1853 Orgelaufstellung, München 1854 Orgelaufstellung, Agram (Kroatien) 1852 Orgelauftrag, 1855 Orgelaufstellung, Wesserling (Franz. Schweiz) 1857 Orgelaufstellung, London 1857, Paris 1857, Lausanne 1857, Mülhausen i. Eis. 1857. Mit welchen Schwierigkeiten er da zu kämpfen hatte, macht man sich heute nur schwer klar. So berichtet er von Lambsheim u. a.: „Unsere Geschäfte gingen auch sonst vonstatten, wenn wir nicht dadurch einen Aufenthalt und bedeutende Arbeit hätten, dass die große Orgel in der Evangelischen Kirche um ein Drittel in der Höhe abgenommen werden musste. Das Gehäuse ist wahrscheinlich durch eine Irrung des Maßes um ein Drittel höher gebaut worden, als der Raum ist, in dem sie untergebracht werden sollte." „Heute erhielt ich das zweite Drittel der Akkordsumme aus der Gemeindekasse in Lambsheim, und damit Ihr doch ja nicht in Verlegenheit seid, entschloss ich mich sogleich, mit 2000 Gulden hierher nach Mannheim zu reisen, weil sonst keine sichere Gelegenheit zu finden war. Euch dieselben mittels Anweisung zu schicken." In Helsingfors wurden Eberhard Friedrich und sein Sohn Heinrich, den er zur Unterstützung mitgenommen hatte, zuerst krank, und sie hatten keinen Menschen, mit dem sie sich verständigen konnten.
|